„Lügenpresse!“ im Licht der Kommunikationswissenschaft
20. April 2015 Hinterlasse einen Kommentar
 Von Prof. Lutz Hagen, Technische Universität Dresden:
Von Prof. Lutz Hagen, Technische Universität Dresden:
Journalistische Qualität zwischen Ressourcenkrise und entfesseltem Publikum
Kritik an den Medien wird dieser Tage nicht nur in den Sprechchören von Pegida geübt. Journalistische Qualität ist wie nie zuvor zum öffentlichen Reizthema geworden: Der aus dem Kontext gerissene Stinkefinger des Varoufakis, der fehlende Hinweis auf die Inszenierung von Staatschefs bei einer Demo in Paris und die vermeintliche Russlandfeindlichkeit der Medien sind nur Beispiele. Auf den Straßen, an den Stammtischen, in den Foren und Kommentarspalten des World Wide Web und nicht zuletzt in den Massenmedien selbst wird derzeit unablässig über journalistische Qualität diskutiert, mit ihr gehadert und über sie gepöbelt. Wie kommt es dazu? Und welche Berechtigung hat es?
Fehler gehören zum Geschäft
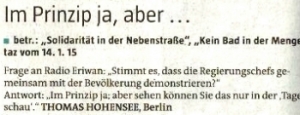 Wo unter hohem Aktualitätsdruck Nachrichten gemacht werden, da passieren Fehler. Das gehört zum Geschäft. Schon vor rund achtzig Jahren hat eine frühe Studie die Sorgfalt von Tageszeitungen kommunikationswissenschaftlich untersucht, indem sie die Berichterstattung auf logische Konsistenz geprüft und mit Quellen abgeglichen hat. Der Befund lautete, dass in nahezu jeder zweiten Nachricht zumindest irgend ein einfaches Faktum nicht stimmte.
Wo unter hohem Aktualitätsdruck Nachrichten gemacht werden, da passieren Fehler. Das gehört zum Geschäft. Schon vor rund achtzig Jahren hat eine frühe Studie die Sorgfalt von Tageszeitungen kommunikationswissenschaftlich untersucht, indem sie die Berichterstattung auf logische Konsistenz geprüft und mit Quellen abgeglichen hat. Der Befund lautete, dass in nahezu jeder zweiten Nachricht zumindest irgend ein einfaches Faktum nicht stimmte.
Zum Lügen gehört allerdings mehr, nämlich die Unwahrheit wissentlich zu verbreiten. Dass man dies den deutschen Medien pauschal vorwerfen könnte, dafür finden sich in der kommunikationswissenschaftlichen Forschung keine Belege. Allerdings mag man der Kommunikationswissenschaft selbst zum Vorwurf machen, dass sie Untersuchungen zur Richtigkeit von Nachrichten nur in geringer Zahl vorzuweisen hat. Denn sie sind schwer zu bewerkstelligen oder zumindest sehr aufwändig – auch wenn man als Wissenschaftler mehr Zeit zur Verfügung hat als ein Journalist. Sicher ist aber: Auch heutzutage passieren Fehler, und das nicht zu knapp! Dies hat sich etwa im Fall der oft kritisierten Kriegsberichterstattung aus der Ukraine mehrfach gezeigt. Erst wurden Panzer und dann sogar die Verantwortlichen für Tötungen der falschen Kriegspartei zugeordnet – das sind die bekannten Fälle, in denen man sich korrigieren musste. Ob aber die Berichterstattung in diesem Fall schlechter war als in früheren Kriegen, ob dahinter wirklich ideologische Faktoren stehen, das muss erst noch gründlich untersucht werden.
Umwertung der Nachrichtenfaktoren
Ein wesentlicher Teil der Kritik, der unter dem Schlagwort „Lügenpresse“ zusammengefasst wird, bezieht sich allerdings überhaupt nicht auf Wahrheit, sondern auf ein anderes zentrales Qualitätskriterium: Relevanz. Die Frage was wichtig ist, ist eben auch wichtig im Journalismus. Nur lässt sie sich im Gegensatz zur Frage nach der Wahrheit ungleich schwerer und stets nur durch Bezug auf grundlegende Werte und politische Prioritäten beantworten. Wie viele Artikel muss man über neue Heime für Asylbewerber in Dresden bringen, wie viele über den Semperopernball? Verdient das Massaker in der Charlie Hebdo-Redaktion mehr Aufmerksamkeit als die Schandtaten von Boko Haram? Jeder, der Nachrichten verfolgt, hat dazu eine eigene Meinung. Aber was ist journalistisch angemessen?
Viele kommunikationswissenschaftliche Studien belegen, dass die Auswahl von Nachrichten sich mit wenigen Nachrichtenfaktoren gut erklären lässt: Relevanz, Nähe, Dynamik etc. Diese Untersuchungen zeigen aber auch, dass in den vergangenen Jahrzehnten eine Umwertung der Nachrichtenfaktoren stattgefunden hat: Negativismus und Drama sind noch einflussreicher geworden als sie es seit jeher waren. Daneben kommt der Aktualität im Sinne von Schnelligkeit inzwischen eine immer dominantere Rolle zu. Doch Geschwindigkeit und Sorgfalt stehen im Zielkonflikt.
Qualitätsverluste
Fest steht, dass wir in Deutschland nach wie vor im professionellen Bereich über so viele qualitativ hochwertige Medien verfügen wie noch nie. Fest steht aber auch, dass qualitativ hochwertiger Journalismus so stark bedroht ist wie noch nie. Schon für die vergangenen Jahrzehnte haben wissenschaftliche Untersuchungen Prozesse der Boulevardisierung in fast allen Bereichen des Mediensystems festgestellt: Oberflächlichkeiten, Drama, Skandalisierungen und Negatives werden stärker betont. Auch beeinträchtigt das Streben nach möglichst schneller Berichterstattung andere Qualitätsmerkmale. Relevanz oder Wahrheit bleiben zugunsten der Schnelligkeit tendenziell häufiger auf der Strecke. Die aktuelle Kritik an der substanzlosen und effekthascherischen Berichterstattung mancher Medien über den Absturz von Germanwings 4U9525 passt genau in dieses Bild.
Und es gibt weitere Trends, die kritisch zu sehen sind: Der Einfluss von Öffentlichkeitsarbeit und anderen externen Quellen nimmt zu und die Berichterstattung wird meinungslastiger. Eine Verringerung der Vielfalt ist nicht nur im Hinblick auf die Regionalausgaben von Zeitungen festzustellen. Auf nationaler Ebene wird zunehmende Konsonanz bisweilen als Folge einer stärkeren Orientierung von Journalisten an den eigenen Kollegen konstatiert (Rudeljournalismus). Für all diese Tendenzen gibt es Belege aus der deutschen oder der internationalen Kommunikationswissenschaft. Allerdings fehlen für Deutschland Studien, die die Entwicklung verschiedener Qualitätskriterien über längere Zeitraum einheitlich und verlässlich messen. In der Schweiz ist das anders, dort veröffentlich das  Jahrbuch Medien seit vier Jahren valide Qualitätsmessungen über eine Reihe wichtiger Indikatoren, die bei mehreren Dutzend Publikationen aus allen wichtigen Mediengattungen vorgenommen werden. Die Befunde zeigen vor allem, dass die Qualität sehr stark mit der Mediengattung schwankt. Während man mit den Abonnementzeitungen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zufrieden sein mag, geben vor allem Online-Medien Grund zur Sorge (Abbildung links). Allerdings ist in den meisten Gattungen ein deutlicher Abwärtstrend der Qualität im Verlauf der vier Jahre zu verzeichnen, was sich auch in einer verringerten thematischen Vielfalt äußert. Es ist sicher ein Desiderat für die deutsche Kommunikationswissenschaft, ein ähnlich umfassendes und gründliches Instrument zu entwickeln und kontinuierlich anzuwenden.
Jahrbuch Medien seit vier Jahren valide Qualitätsmessungen über eine Reihe wichtiger Indikatoren, die bei mehreren Dutzend Publikationen aus allen wichtigen Mediengattungen vorgenommen werden. Die Befunde zeigen vor allem, dass die Qualität sehr stark mit der Mediengattung schwankt. Während man mit den Abonnementzeitungen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zufrieden sein mag, geben vor allem Online-Medien Grund zur Sorge (Abbildung links). Allerdings ist in den meisten Gattungen ein deutlicher Abwärtstrend der Qualität im Verlauf der vier Jahre zu verzeichnen, was sich auch in einer verringerten thematischen Vielfalt äußert. Es ist sicher ein Desiderat für die deutsche Kommunikationswissenschaft, ein ähnlich umfassendes und gründliches Instrument zu entwickeln und kontinuierlich anzuwenden.
Die Ressourcenkrise
Diese Ursachen für diese Entwicklung haben schon vor Jahrzehnten eingesetzt und hängen vor allem mit Deregulierungsmaßnahmen und zunehmendem Wettbewerbsdruck zusammen, der sich wegen der vielen Unvollkommenheiten von Medienmärkten ungünstig auf die Qualität auswirkt: So kann das Publikum einige Qualitäten von Nachrichten schwer oder nicht beurteilen (etwa deren Wahrheit). Außerdem weisen Medien Merkmale von öffentlichen Gütern oder sogar von meritorischen Gütern auf, die beide dazu führen, dass Märkte versagen. Daneben spielte in der Vergangenheit, gerade bei der Umwertung der Nachrichtenfaktoren, die Etablierung des Fernsehens als Leitmedium eine Rolle und in letzter Zeit natürlich der Aufstieg des Internets. So haben die zeitgleich berichtenden Online-Medien den Aktualitätsdruck auf das maximal Mögliche erhöht.
In den digitalen Netzen steht überdies journalistische Information zuhauf öffentlich und kostenlos zur Verfügung, während Zeitungen und Zeitschriften eine Abwärtsspirale durchlaufen, bei der sie Abonnenten und Anzeigenkunden verlieren. Spektakulär hohe Klickraten und Besucherzahlen, die einige Nachrichtenmedien in den Netzen erzielen, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Geschäftsmodelle des Nachrichtenjournalismus in der digitalen Welt nicht mehr funktionieren. So hat nach den Schätzungen von statista.com die Bild-Zeitung als ertragsstärktes deutsches Nachrichtenportal im Jahr 2013 nicht einmal 50 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Das dürfte weit weniger als ein Zehntel dessen sein, was die im Auflagensturzflug befindliche Printausgabe im selben Jahr noch an Einnahmen generiert hat.
D. h. wir stecken in einer massiven Finanzierungskrise des professionellen Journalismus, die die Informationsinfrastruktur unserer Demokratie bedroht. Qualität gibt es nicht umsonst. Auch der steigende Anteil Anzeigenfinanzierung ist nicht unproblematisch, wie Studien zum Zusammenhang zwischen Anzeigenvolumen und redaktioneller Berichterstattung zeigen.
Entfesseltes Publikum
Vieles spricht allerdings dafür, dass die massive Medienkritik dieser Tage nicht allein mit zunehmenden Qualitätsmängeln des Journalismus zusammenhängt. Die Digitalisierung führt durch verschiedene Mechanismen zur Delegitimation der Massenmedien.
Erstens ist im Internet eine zweite mediale Öffentlichkeit entstanden. Sie ermöglicht es, Fakten aus den traditionellen Massenmedien kritisch zu hinterfragen und an anderen Quellen zu prüfen. Diese anderen Quellen, Blogs oder Videos von Amateuren zum Beispiel, sind aber in großen Teilen unzuverlässiger oder zumindest in ihrer Qualität schwerer einzuschätzen als professionelle journalistische Quellen. Gleichwohl werden hierdurch Fehler, die der traditionelle Nachrichtenjournalismus begeht, sehr viel leichter offenbar. So ist es inzwischen möglich geworden, dass ein Internet-Forum wie die „Ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien“ (www.publikumskonferenz.de) nicht nur Kritik an der journalistischen Qualität veröffentlicht, sondern durch Progammbeschwerden einigen Journalisten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunks das Leben schwer macht.
Zweitens wird durch das Internet die menschliche Neigung begünstigt, eher Informationen aufzunehmen, die konsonant, also im Einklang mit dem sind, was man bereits weiß und meint und sich eher im Dialog mit Seinesgleichen zu bestätigen, als sich mit möglicherweise zutreffenderen alternativen Sichtweisen zu befassen. Dies wird insbesondere durch automatische, algorithmisch gesteuerte Selektionsmechanismen begünstigt, die z. B. bei Facebook und Google die Nachrichten bestimmen. Aber auch durch Foren und soziale Netzwerke, in denen sich Gleichgesinnte wechselseitig bestätigen (homophile Sortierung) tragen zur einseitigen Information bei. Die Gefahr wächst, in einer „Filter Blase“ nur noch Bestätigung zur erfahren aber wenig Information zu erhalten, die die eigenen Ansichten kritisch herausfordert.
Als dritter Faktor trägt die Anonymität in den Netzen dazu bei, dass Anstandsregeln eher missachtet werden, die für rationale und fruchtbare Diskussionen gelten. Zu oft vergiften Trolle den Diskurs in den Kommentarspalten und in den Foren. Das färbt auch auf die Stimmung und auf den Tonfall öffentlicher Auseinandersetzungen im Allgemeinen ab und mag darin einen Grund für die Unversöhnlichkeit und den harschen Ton sehen, der z. B. in der Auseinandersetzung zwischen der Pegida-Bewegung und ihren Gegnern herrscht.
Und nun?
Auch wenn das Etikett „Lügenpresse“ falsch ist, auch wenn die digitale Öffentlichkeit Medien delegitimiert: Die zunehmende Kritik am Journalismus wird zumindest teilweise auch durch journalistische Qualitätsverluste verursacht. Wünschenswert ist zunächst, dass diese Entwicklung durch umfassende, kontinuierliche und valide wissenschaftliche Untersuchungen genauer spezifiziert und verfolgt wird.
Dass die Medien bei der Ausübung ihrer öffentlichen Aufgabe, die auch Kritik und Kontrolle umfasst, vor allem in der digitalen Sphäre nun selbst verstärkt kritisiert und kontrolliert werden, sollte man nicht nur als Problem, sondern vor allem auch als Chance begreifen – ein Chance auf mehr Sorgfalt, mehr Rechenschaft und bessere Publikumsorientierung in Zusammenarbeit mit dem Publikum.
Es fällt weniger leicht, der anderen Hauptursache von Qualitätsproblemen etwas Positives abzugewinnen. Die Ressourcenkrise wird solange andauern und sich verschärfen, wie keine neuen Geschäftsmodelle bzw. Organisationsformen für Angebote im Internet gefunden werden, die endlich eine angemessene, unabhängige Finanzierung des Nachrichtenjournalismus ermöglichen.